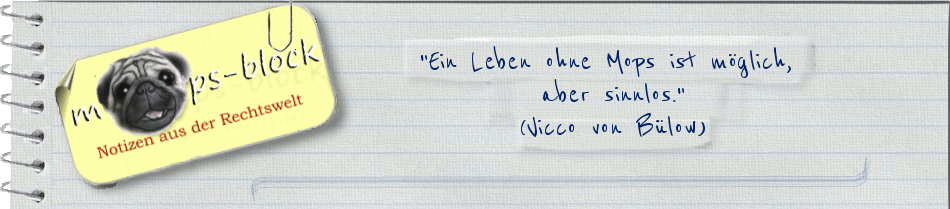Mai 1957. München. Das Sommersemester beginnt. Zweiter Mittwoch des Monats, 18.15 Uhr. Professor Wolfgang Kunkel eröffnet sein rechtshistorisch-romanistisches Seminar. Ich bin aufgenommen. Kunkel war der einzige gewesen, der mich zugelassen hatte. Bei Engisch und Larenz hatte ich vergeblich angeklopft. Ich konnte keine Qualifikationsnachweise vorlegen und scheiterte schon im Sekretariat. Kunkel hatte mich vorgelassen und nicht nach Leistungsscheinen gefragt. Nur nach Interessen und dem Schulabschluss. Das humanistische Gymnasium Kaiserslautern enthob mich weiteren Befragungen. Ich war willkommen.
Es war mein erstes Seminar an der Universität. Von Mitstudierenden hatte ich gehört, dass man im 5. Semester in ein Seminar gehen solle. Um einen Professor kennen zu lernen. Ich hatte Engisch kennen lernen wollen. Er hielt großartige Vorlesungen. Die Daumen eingehakt in seine Hosenträger, schritt er hin und her, warf einen philosophischen Satz oder Spruch in die Luft, zog einen Gedanken heraus und dann einen zweiten, drehte sie hin und her, entwickelte, widerrief, riss die Hörer in den Denkprozess, entließ sie lächelnd und mit einem Spruch auf den Heimweg. Obendrein war er sympathisch. Larenz hatte ich eigentlich nicht kennenlernen wollen. Er hielt grauenhaft langweilige Vorlesungen, las einfach sein elegant geschriebenes und weithin gepriesenes Lehrbuch vor. Außerdem war er mir unsympathisch. Obwohl ich von seiner gloriosen Vergangenheit noch überhaupt nichts wusste. Ein hochaufgerichteter Stockfisch. Aber der Junge, dem ich vertraute, hatte gesagt: „Frag nur bei den Besten nach, die Anderen nehmen dich sowieso.“ Larenz gehörte zweifellos zu den Besten.
Kunkel rechnete ich zu den Anderen. Ich kannte ihn aus den Heidelberger Vorlesungen zur römischen Rechtsgeschichte und zum römischen Privatrecht. Die Materie hatte mir zugesagt, der Vortrag nicht. Klar und schnörkellos, aber ohne rhetorisches Feuer. Die pure analytische Vernunft, vorsichtig, sachlich, abwägend. Liebenswürdig, gewiss – aber, wenn man aus Forsthoffs Vorlesung kam... Irgendwie waren Kunkels Dinge doch alter Kram gewesen.
Jetzt war ich zwangsläufig wieder auf dem Weg zum alten Kram.
Ich betrat das „Haus des Rechts“, schlüpfte zwischen den mächtigen Säulen hindurch, die ihre faschistische Vergangenheit nicht zu verbergen suchten, stieg die Marmorstufen empor, wandte mich im obersten Stockwerk nach links und wanderte bis ans Ende des dunklen Ganges. Eine Glastür. Dahinter rechts das Sekretariat, links der Eingang zum quadratischen Seminarraum. Große, hohe Fenster mit Blick auf das handgreiflich nahe Siegestor. Es gab erst wenige Bücher. Kunkel hatte die Bibliothek des gelehrten österreichischen Rechtshistorikers Leopold Wenger zwar schon erworben, aber die riesige Wenger-Bibliothek war noch nicht geliefert und noch nicht aufgestellt. Letzteres habe einige Semester später ich besorgt. Das Institut hieß auch noch nicht Leopold-Wenger-Institut, und der stilgerecht zum Hauptgebäude passende Anbau an das „Haus des Rechts“, der es später beherbergte, lag noch in unvorhersehbarer Zukunft.
Drei männliche Wesen waren schon anwesend als ich den Raum betrat. Tycho Mrsich, über Zettel gebeugt, lächelte schief von unten als ich fragte, ob ich mich neben ihn setzen dürfe. „Freilich“, sagte er. Er schien mir älter als ich, erfahren, neugierig und weise zugleich – ein gelehrter Kobold. Er sollte mein engster Freund und der langjährige Vertraute meines Lebens werden, dessen Tür sich immer noch geräuschlos öffnet, wenn ich anklopfe.
Gegenüber saß ein grimmig blickender Wissenschaftler. Ein erfahrener Recke. Kienast hieß er. Vermutlich habilitiert, jedenfalls abgeschlossen und auf dem Sprungbrett. Altorientalist, Assyriologe, Keilschriftrechtler, Ur, Akkad, Babylon, des Arabischen kundig. Nach Semesterschluss verschwand er auf Nimmerwiedersehen, ohne jemals auf den Sitzungen das Wort ergriffen zu haben. Nach Amerika soll er gegangen sein und in Chicago unter Seinesgleichen berühmt geworden. Mir hinterließ er in einer Pause, die kantige Miene ironisch gefaltet, die Information, dass er seinen Lebensunterhalt mit der Übersetzung von Gebrauchsanweisungen für Präservative ins Arabische verdiene. Eine deutsche Gummiwarenfabrik hatte die seltene Kompetenz entdeckt und in Dienst genommen.
Der dritte Teilnehmer war wesentlich jünger als die beiden anderen. Ein Konsemester, wie man gesagt hätte. Gänzlich unbefangen. Seminarerfahren zeigte er dem Professor gern, dass er ihm gewogen sei. Redete viel und betonte häufig, dass er weniger in der Antike als im Mittelalter „zuhause“ sei. Er kannte manchen rechtshistorischen Professor persönlich, wie es schien, und hatte, wie er mir bedeutete, ein freundschaftliches Verhältnis zu diesen großen Männern. Er hieß Peter Weimar, verschwand nach jenem Semester ebenfalls und hat in seiner Community, in der er „zuhause“ war, keine Spuren hinterlassen. Die Züricher Rechtsfakultät hat ihn irgendwann in ihre Reihen berufen und hat diesen Fehler damit bezahlt, dass sie für einige Wochen bundesweit zitiert wurde, als ihr Mitglied Weimar nächtlich versuchte, die Katze seiner Tochter strafweise im Zürichsee zu ertränken – ein Akt für den unter Rechtshistorikern nur Gerhard Thür Verständnis aufbrachte, der viele Jahre später meiner Entrüstung mit der Bemerkung begegnete: „Herr Simon, sie haben keine Töchter“.
Um 18.12 Uhr öffnete sich die große Tür, und Kunkel betrat den Raum, gefolgt von zwei weiteren Teilnehmern – einem glattgesichtigen, straffen Blonden vom Typus Unteroffizier der Wehrmacht und einem etwas schlaksigen Samtäugigen, der, obwohl kaum älter als ich, wegen seiner Körpergröße leicht gebeugt ging, neben dem Straffen eher zu schlurfen schien und zerstreut in die Runde grüßte.
Der Erste hieß Rosenthal und hatte eine Funktion. Er war Assistent.
Der Zweite sagte mir am Ende dieser ersten Stunde, er heiße Dieter Nörr und freue sich, dass ich mitmachen würde. Womit er nach Kunkel der Zweite und viele Jahre der Letze war, der mich in der Rechtsgeschichte willkommen hieß. Der Dritte und wirklich Letzte war Wieacker – aber das war erst anlässlich seiner liebenswürdigen Gratulation zu meiner Promotion.
Der Assistent sagte nichts. Der kundige Weimar berichtete, dass Rosenthal keineswegs ein genuiner Kunkel-Schüler sei, sondern eine Art Flüchtling, dass sein wahrer Lehrer ein gewisser Heinrich Siber, ein Romanist, gewesen wäre, der jüngst, ungelitten wegen seines Wirkens in den fatalen Jahren, in Leipzig verstorben, den Rosenthal dem Kunkel, von Romanist zu Romanist, gleichsam vererbt habe, so dass dieser, gutmütig wie er sei, Unterkunft und Auskommen geboten habe. Was Rosenthal jedenfalls nicht sonderlich zu würdigen wusste, denn statt zu habilitieren, wozu er angestellt worden war, zeugte er lediglich einen Sohn, über dessen Aussehen, Größe und Gewicht er sich von Sitzung zu Sitzung in immer eingehenderen Schilderungen erging, während sich seine wissenschaftlichen Äußerungen in sonderbarem, aber stets schneidig vorgetragenem Jokus erschöpften. Nach einigen Semestern verschwand er, vermutlich aufgrund meiner tiefinnerlichen Verwünschungen, die er sich zuzog als er mich, soeben stolzgeschwellt zur wissenschaftlichen Hilfskraft ernannt, einem spanischen Gastprofessor (Alvaro d'Ors) als „Simon, unser Faktotum“ vorstellte. Ich wünschte ihm nichts Gutes – weiß aber nicht, ob meine Wünsche in Erfüllung gingen.
Kunkel begrüßte die Anwesenden, stellte mich als Neuling und „weiteren Studenten“ vor und begann die Sitzung mit dem Satz:
„Sie werden mich fragen, warum wir uns in diesem Semester mit den römischen Privaturkunden befassen wollen“.
Ich fragte naturgemäß nichts, denn einerseits ahnte ich schon, dass es sich um eine rhetorische Ansage handelte, andererseits hätte ich mich unter keinen Umständen getraut, in einem solchen Falle und an diesem Platz eine Frage zu stellen, und drittens verstand ich nicht im mindesten den Grund, warum ich derlei hätte fragen sollen. Denn, dass man in einem romanistischen Seminar traditionell das Corpus Iuris Civilis zu traktieren hatte und sonst nichts, war mir bis dahin nicht bekannt geworden.
Kunkel machte eine kleine Pause und blickte in die Runde.
Tycho Mrsich schrieb etwas in winziger Schrift auf kleine Zettel, Kienast hatte das Gesicht in die linke Hand gestützt und hielt seine grimmige Miene reglos, Weimar setzte zu einem albernen Lachen an, das aber unter Rosenthals Kasernenhofblick erstarb, Nörr lächelte – er lächelte sein großartiges, ein wenig maliziöses, ein wenig ironisches Lächeln, an dem seine Freunde ablesen konnten, dass er wusste oder zumindest ahnte, was kommen würde.
Und Kunkel beantwortete die von ihm angeregte, aber ungestellt gebliebene Frage, denn auch selbst:
„Nun, das muss auch einmal sein.“
Damit war es heraus, und alle außer Nörr nickten. Ich nickte auch.
Es wurden Aufgaben verteilt. Weimar erhielt eine und bat sogleich, wegen dringlicher Geschäfte erst gegen Ende des Semesters zum Vortrag gebeten zu werden. Schon war ich an der Reihe und Kunkel fragte mich, ob ich bereit sei, die Tabula Baetica zu interpretieren, wobei es sich, wie wohl alle außer mir wussten, um eine im spanischen Guadalquivir gefundene Bronzetafel mit einem Kaufvertragsformular handelt.
Auf der Umschau nach einem weiteren potenziellen Referenten schweifte der Blick des gütigen Patriarchen noch ein oder zweimal in die kleine Runde und blieb dann endgültig an mir hängen. Ob er es mir wohl zumuten könne, bereits in der nächsten Stunde zu beginnen. Ich sagte beklommen zu, und um 19.00 Uhr als Eröffnung und Orientierung beendet wurden, fragte ich Nörr, wo sich die Tabula Baetica befinde, was eigentlich von mir erwartet werde, was ich lese müsse, was ich lesen solle, ob ich etwas schreiben müsse und, wenn ja, was.
Dieter Nörr erklärte mir alles und jedes; rasch zog er eine Edition aus dem Regal, deutete auf ein Wörterbuch, nannte eine Monographie, umriss den Standard, kennzeichnete die Hürden, erzählte, was Kunkel erwarten würde und empfahl mit seiner weichen, nur mit einem ganz fernen süddeutsch-bajuwarischen Klang gefärbten Stimme, einen freien, nur am Text orientierten und durch ihn gebundenen Vortrag.
Als ich eine Woche später meinen Vortrag begann, saß ich neben ihm. Als ich zwei Stunden später verschwitzt endete und Kunkel mich bat, den Vortrag in der nächsten Stunde fortzusetzen – ein Vorgang, der sich dann bis zum Semesterende repetierte, so dass ich schließlich der einzige Referent blieb und auch noch den frohlockenden Weimar entlastete - als ich mich in diesem Moment mit fragendem Blick Nörr zuwandte, da rundete er unter dem Tisch Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand zum Kreis und bewegte die Hand, die letzen drei Finger emporgereckt, zweimal auf und nieder, um mir mit dieser verbreiteten rhetorischen Geste die Wohlgelungenheit meiner Ausführungen zu signalisieren.
Von diesem Augenblick an fand ich den vier Jahre Älteren, der als Schüler des zwei Jahre zuvor gestorbenen Mariano San Nicolò galt und der soeben mit einer Arbeit über „die Fahrlässigkeit im byzantinischen Vertragsrecht“ zu verstehen gab, dass er kaum die Wege des klassischen rechtshistorischen Romanisten in der Gefolgschaft der Pandektistik des 19. Jahrhunderts beschreiten würde – von diesem Augenblick an fand ich diesen Mann großartig und vorbildlich und nachahmungswürdig, und ich nahm mir vor, es ihm möglichst gleich zu tun.
Das ist dann so nicht gekommen. Vielleicht schon deshalb, weil der Mensch dazu neigt, nicht mehr zu wollen, was er nicht kann. Vielleicht auch deshalb, weil mir nicht mehr gefiel, was ich gekonnt hätte. Wie dem auch sei: Nörr habilitierte sich und ging nach Münster. Er entwickelte sich zum führenden Rechtshistoriker meiner Generation. Ein differenzierter und unendlich breit gebildeter Gelehrter, der nicht müde wurde, neue, bis dahin ungestellte Fragen aufzuwerfen und sie in einer eleganten und vornehmen Sprache zu behandeln. Ein europaweit bedeutender, konservativer Intellektueller, ein mitreißender Gesprächspartner und eindringlicher Beobachter des Rechts, dessen verschlungener Pfade und stupenden Adepten und Verwalter.
Unsere Wege haben sich nach den wenigen Semestern, die wir gemeinsam in Kunkels Seminar saßen, nie wieder vereint. Nörr zog nach Münster. Ich blieb in München, erlebte Hans Kiefner, Diederich Behrend, Günther Jahr, Uwe Wesel, Juan Miquel, Bruno Schmidlin und viele andere und ging 8 Jahre später, kurz bevor Nörr nach München als Kunkels Nachfolger zurückkehrte, nach Frankfurt am Main.
Unsere Ansichten und Weltsichten sind auseinander gedriftet. Wir sind uns auf mancherlei Kongressen begegnet und haben vertraut und freundschaftlich miteinander gesprochen. Und immer ein bisschen bedauert, dass die Entfernung zwischen uns so groß geworden war. Riesengroß. So groß, dass man sich kaum noch wahrnehmen konnte.
Ich habe ihn stets bewundert und seine Texte begeistert als Aufklärung und mit Genuss studiert. Wenn er die meinen gelesen haben sollte, wird er ihnen sein feines, ironisches Lächeln und einen Seufzer geschenkt haben. „Ach, Dieter“.
Vor einigen Tagen ist Dieter Nörr mit 86 Jahren gestorben. Als mich Guido Pfeifer informierte, stieg die Erinnerung auf. Jetzt sehe ich: Der Strom ist verrauscht und hat in einem dürren Bachbett ein dünnes Rinnsal namens deutsche romanistische Rechtsgeschichte zurückgelassen.