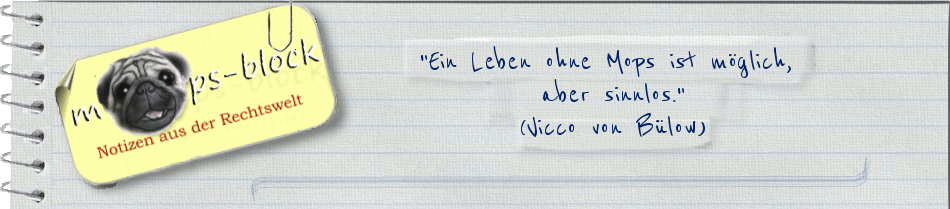Seit langem steht für mich fest: Im nächsten Leben werde ich drei Dinge grundsätzlich anders machen:
1. Ich werde Vegetarier. Ich bin das elende Gefühl satt, das mich regelmäßig beim Fahren auf der Autobahn beim Anblick von Tiertransporten überfällt. Auch habe ich noch die tiermehlgestopften Kühe vor Augen, die sich im Rinderwahn vor den TV-Kameras drehten. Und selbst beim tapferen Kampf unserer Gerichte um die Anzahl der Quadratzentimeter, die einer Legehenne von Rechts wegen zustehen, finde ich keinen Trost. All´ das bedrückt mich, verblasst aber am Horizont der schlechten Gefühle, wenn ich dem Duft einer auf dem Rost brutzelnden Schweinsbratwurst oder einer im Ofen der Vollendung entgegengarenden Hammelkeule ausgesetzt werde. Insofern bringt mich der naheliegende Hinweis, ich bräuchte doch nicht auf das nächste Leben zu warten, sondern könnte schon hic et nunc aus dem festgestellten Dilemma moralisch wertvolle Konsequenzen ziehen, nicht weiter. Fleischgenuss zählt seit Jahrzehnten zu meinen Schwächen, und daran wird in absehbarer Zeit auch kein Dönerskandal mehr etwas ändern. Also bleibt nur die Hoffnung auf das Jenseits.
2. Da werde ich dann auch an dem zweiten Komplex arbeiten, der mich in meinem Diesseits zunehmend stört: Ich werde Fremdsprachen lernen. In diesem Leben ist es mir relativ spät aufgegangen, wie sehr es doch das Dasein einengt, wenn man sich nur in seiner Muttersprache so ausdrücken kann, wie es einem vorschwebt. Klar kann ich in munterem Italienisch ein Abendessen bestellen, und auf dem Flughafen von Hongkong komme ich mit meinem Schul-Englisch mühelos zurecht. Aber dass das etwas wenig ist, um sich in der Kommunikationswelt wohl zu fühlen, habe ich spätestens bei meiner Annäherung an das kleine Nachbarland Schweiz gemerkt, das durch die omnipräsente Vielsprachigkeit weit mehr geprägt ist, als durch Toblerone, Käse oder Bankgeheimnis. Das Verwiesensein auf liebliches Lächeln, wenn in einer Gesprächsgruppe der Nachbar zur Rechten plötzlich mit einem Hinzukommenden mühelos und anspruchsvoll französisch parliert, während der links Sitzende die auf Deutsch geführte Unterhaltung nahtlos ins Italienische gleiten lässt, weil sich ein Tessiner eingeschaltet hat, macht mich zunehmend unfroh. Also werde ich im nächsten Leben fleißiger sein und mit dem – nicht nur tourismustauglichen – Lernen von Fremdsprachen zu einer Zeit beginnen, zu der dies noch den gewünschten Erfolg verspricht.
3. Am wichtigsten aber war mir immer der dritte Punkt: Die Berufswahl. Jura, so denke ich seit langem, werde ich nicht mehr studieren. Obwohl ich damit in diesem Leben nicht schlecht gefahren bin, hat sich bei mir ein wachsendes Unbehagen beim Umgang mit normativen Sätzen eingestellt. Diese in die Welt der Tatsachen zu überführen und dabei erhobenen Hauptes an die strikte Rationalität dieses Vorgangs zu glauben (dies jedenfalls nach außen vorzugeben), wurde für mich im Laufe meines Berufslebens immer unattraktiver. Ich konnte mich des historisch gestützten Eindrucks nicht erwehren, dass die juristischen Denkmodelle seit jeher nur dem Zwecke dienten, redliche oder unredliche Überzeugungen und nicht etwa Richtigkeit zu transportieren, ohne dass daraus die nahegelegten Schlüsse gezogen würden – von der mitgelieferten Legitimation von Jedem und Allem ganz zu schweigen. Natürlich hat mich mein zunehmendes Missvergnügen an der professionalisierten Vermischung von Wissen und Wollen auch für andere normative Wissenschaften unbrauchbar gemacht, so dass ich beschlossen habe, im nächsten Leben Verhaltensforscher zu werden. Da kann ich Graugänse beobachten und diese Beobachtungen aufschreiben. Und ich werde mich hüten, daraus Sollenssätze abzuleiten, etwa über natürliches Aggressionsverhalten, das in bestimmter Weise domestiziert werden müsse. Das würde ich mir nicht einmal gegenüber den Graugänsen erlauben.
4. So dachte ich bis gestern. Da las ich im Handelsblatt vom 29. 11. unter der Überschrift Der Kampf um das Erbe der Lehmann Brothers, wie sich das Insolvenzverfahren dieser Schicksalspleite in unserem Land gestaltet. Und ich beschloss sofort: Im nächsten Leben werde ich Insolvenzverwalter. Um das Jurastudium werde ich dann wohl doch nicht herumkommen, aber was soll´s – jeder Aufwand lohnt sich! Michael Frege, der die deutsche Tochter der US-Bank als Insolvenzverwalter abwickelt und dabei die Interessen von rund 500 deutschen Gläubigern vertritt, hat in einem Rechtsgutachten des Berliner FH-Professors Ulrich Keller vorrechnen lassen, dass er mit seiner über vier Jahre währenden Tätigkeit auf den Cent genau 833 844 347.92 Euro als Honorar abrechnen dürfe.
Das ist überwältigend. Vor allem deshalb, weil die Vergütungsregelungen von Insolvenzordnung und Insolvenzrechtlicher Vergütungsverordnung bei unschuldiger Betrachtungsweise nur 42 Millionen als angemessen ausweisen, also gut 5 % der von Keller ermittelten Mios. Das Vermehrungswunder fast biblischen Ausmaßes erklären Gutachter Keller und die betroffene Kanzlei mit der erfolgreichen Arbeit der Insolvenzverwaltung (tatsächlich wurden immerhin 15 Milliarden an Masse zusammengekratzt, von denen – nach Vorabbefriedigung privilegierter Gläubiger – gut die Hälfte für den gemeinen Gläubiger übrigbleibt), mit der besonderen Kompliziertheit des Falles und mit überobligationsmäßigem Einsatz, welcher die horrenden Zuschläge rechtfertige. Tatsächlich ist eine Quote von knapp 80 % eine schöne Überraschung für die Gläubiger, die mit einem solchen Füllhorn sicher nicht gerechnet haben.
Aber heißt das viel mehr, als dass der Verwalter seine Pflicht getan, die Masse (sicher aufwendig und akribisch) ermittelt und dabei – vor allem wegen der inzwischen eingetretenen Erholung der etwas voreilig als wertlos eingestuften „toxischen“ Derivate – wesentlich mehr vorgefunden hat, als er selbst bei Mandatsübernahme vermuten durfte? Dass er das nicht übersehen hat, ist ihm sicher hoch anzurechnen, aber darf man das nicht vom Insolvenzverwalter auch ohne Zuschläge erwarten? Hätte er weniger geleistet, wenn sich der Bankensektor nicht erholt, die Papiere wirklich als wertlos herausgestellt hätten? Und wäre er dann (weil nach dem Gesetz die Masse gleichzeitig Bezugsgröße seines Regelhonorars ist - maximal allerdings nur 0.5 %) mit ganz wenigen Millionen von dannen geschlichen? Hans Gerhard Ganter, früher Richter am BGH, kommt jedenfalls in einem Gegengutachten, das eine um ihre Quote besorgte Gläubigergruppe in Auftrag gegeben hat, zu dem Ergebnis, dass die exorbitante Vermehrung der Regelvergütung nicht mit unerwartbarem Aufwand zu erklären sei. Zusammenarbeit mit dem Gläubigerausschuss etwa zeige, wenn auch vom Gesetz nicht explizit als Verwalterpflicht benannt, nach Ganter kein so übermäßiges Verwalterengagement, dass damit ein Bonus zu rechtfertigen sei, und auch die hohe Zahl der Gläubiger, die Bereitschaft, Formalien einzuhalten oder ,Risiken‘ (für die Werterhaltung der Masse, nicht etwa für das Honorar) zu nehmen, findet nur der Erst-, nicht aber der Gegengutachter zuschlagsträchtig (wobei die Frage, ob das Ganter-Gutachten ebenso ausgefallen wäre, wenn das Schicksal diesen Gutachter auf die andere Seite des Honorarstreits verschlagen hätte, durchaus offen bleiben darf).
Der Kanzlei von Frege, die Sozietät CMS Hasche Sigle, scheint es jedenfalls bereits zu schwanen, dass etwas schief laufen könnte mit den schönen Millionen. Ihr Geschäftsführender Partner, Hubertus Kolster, lässt schon mal verlauten, dass – trotz des immensen Aufwandes – die Vergütung letztendlich auch unter 500 Millionen Euro liegen könnte. Das wären dann zwar immer noch gut doppelt so viele Millionen, wie die gesamte Kanzlei nach Auskunft des Branchendienstes JUVE im Geschäftsjahr 2011 als Umsatz generiert hat, aber letztendlich doch nur 10 Kopper-Erdnüsse und deshalb ziemlich enttäuschend. Falls also dieser Fall wirklich eintritt, werde ich mein Berufsziel für das nächste Leben noch einmal überdenken.
PS: Sozialneid? Aber klar! Wenn ich denke, wieviele Studentenwohnungen von der Differenz zwischen angemessenem und überrissenem Honorar gebaut werden könnten, könnt´ ich platzen vor Sozialneid.
mops-block
Im nächsten Leben ...
- Details